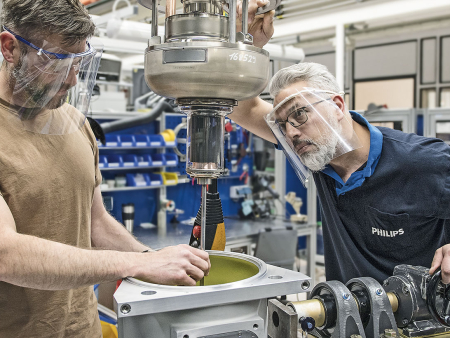Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf im Gespräch mit der WELT über deutsche Standort-Probleme, die Folgen der Europawahl und den Umgang mit China:
Die Ampel ist bei der Europawahl abgestraft worden. Sind Sie damit zufrieden?
Ich bin nicht überrascht und freue mich natürlich über das Abschneiden der CDU. Aber jetzt müssen bei SPD und vor allem bei den Grünen politische Konsequenzen gezogen werden. Die Leute haben – derb gesprochen – die Schnauze voll von der ständigen Gängelung, der Besserwisserei, die einem vermitteln soll, wie man zu leben hat. Viele Regelungen auf europäischer Ebene, wie den Green Deal, wollen die Wähler einfach nicht. Die Europäer wollen auch weiter mit Verbrennungsmotoren fahren.
An welche Konsequenzen denken Sie? Neuwahlen wie in Frankreich?
Das wird nicht funktionieren, denn der Bundeskanzler müsste die Vertrauensfrage stellen. Die Ampelparteien haben nur noch ein Drittel der Wähler hinter sich.
Vor der Wahl hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften dazu aufgerufen, die AfD nicht zu wählen. Wie erklären Sie sich die Zugewinne der Partei?
Viele, die AfD gewählt haben, identifizieren sich nicht unbedingt mit dem Gedankengut der Partei. Sie sind einfach frustriert über die Politik der Ampel. Zwei Themen waren wahlbestimmend: die ungebremste Migration und die Angst vor dem Wohlstandsverlust.
Davon sprechen auch Manager. Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, sieht Deutschland auf dem Weg zum „Entwicklungsland“.
Gut, dass das mal jemand so deutlich sagt.
Das finden Sie gut, so eine Rhetorik? Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ich bin ein Anhänger klarer Worte. Ich war am Anfang auch hoffnungsfroh über die Ampel. Sie ist angetreten mit Plänen zur Transformation und Modernisierung des Landes. Aber was ist seitdem umgesetzt worden? Nichts. Die Unternehmenssteuern sind zu hoch, die Energiepreise und die Arbeitskosten ebenso. Die Sozialversicherungsbeiträge liegen wieder über 40 Prozent – ein gebrochenes Versprechen der Politik. Außerdem belastet die Bürokratie ohne Ende. Die Beschäftigten verstehen das. Sie merken, dass die Rahmenbedingungen immer schlechter werden, was wiederum Arbeitsplätze gefährdet.
Aber das Geschäftsklima hat sich gerade zum dritten Mal in Folge verbessert und die Energiekosten sind gesunken. Ist die tatsächliche Lage nicht besser als Sie behaupten?
Für mich ist 2018 das Maß aller Dinge, unser bislang wirtschaftlich stärkstes Jahr. Von diesem Niveau sind wir entfernt. Andere Länder zahlen einen Bruchteil unserer Energiekosten. Aber hören Sie irgendetwas von unserem Kanzler? Er führt nicht. Ich habe 18 Jahre lang einen Konzern geführt, da müssen immer Alternativen aufgezeigt und Visionen entwickelt werden. Das findet beim Kanzler leider überhaupt nicht statt. „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“, hatte Bundespräsident Roman Herzog 1997 gefordert. So etwas braucht es jetzt wieder.
Fürchten Sie nicht, dass Ihre Warnungen vor dem drohenden Niedergang zur selbst erfüllenden Prophezeiung werden, oder die AfD noch weiter stärken?
Das Risiko gibt es leider. Es ändert aber nichts daran, dass man Missstände benennen muss. Deutschland lebt von der Industrie, da wird das Geld verdient. Und es läuft Gefahr, sich zu einem Standort zu entwickeln, wo Produktion kaum noch möglich ist, wegen der hohen Kosten. Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sind das eine. Das andere ist die Bürokratie, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung: Unternehmen betreiben einen riesigen Aufwand, damit Mitarbeiter A ja keine Daten von Mitarbeiterin B erfährt – dabei sind sie bei Facebook und Instagram befreundet.
Das sind aber Entwicklungen, die auf die Ära Merkel zurückzuführen sind und nicht auf die Ampel.
Das stimmt. Frau Merkel hat die vergangenen vier, vielleicht acht Jahre nur noch verwaltet. Sie hatte dreifaches Glück: Billiges Gas und Öl aus Russland, einen riesigen Absatzmarkt mit China, wo Geld verdient wurde ohne Ende. Und für Sicherheit musste man wenig ausgeben, weil die USA die schützende Hand über Deutschland hielten. Dann kam der Ukrainekrieg und all das ist weggebrochen. Deswegen ist die Ampel nicht an allem schuld. Aber wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen Regierungsverantwortliche handeln.
Was ist die Alternative? Wieder mehr auf China setzen, so wie die BASF, die dort massiv investiert?
BASF bleibt nichts anderes übrig. Ich finde das nachvollziehbar, angesichts der hohen Preise für Energie. Der Maschinenbau und andere Branchen verdienen richtig gut in China. Die Waren fließen aus Deutschland dorthin, weil deutsche Produkte gefragt sind. Darin sehe ich nichts Verwerfliches.
Verwerflich wird die Abhängigkeit spätestens, wenn China Taiwan überfällt.
Aber sie haben es noch nicht getan. Wenn das passieren würde, und wir die Handelsbeziehungen mit China einstellen würden, hätte die deutsche Industrie natürlich ein massives Problem. Diese Abhängigkeit ist einfach da.
Müsste man nach der Erfahrung mit Russland nicht in Bezug auf China eine Risikovorsorge treffen – für den Fall, dass es knallt?
Ja, das denke ich schon. Viele Unternehmen investieren auch in Länder wie Indien. Auch Südosteuropa ist ein guter Standort, wobei dort mittlerweile die Arbeitskosten davongelaufen sind. Das ändert aber nichts daran, dass China ein riesiger Markt ist und die Rahmenbedingungen dort gut sind.
Die EU hat nun Importzölle auf E-Autos aus China angekündigt. Was halten Sie davon?
Ich halte das für verheerend. Die Akzeptanz chinesischer Fahrzeuge ist bei uns sehr limitiert. Aber deutsche Autobauer verdienen viel mit ihren Premiumfahrzeugen in China, das sichert Arbeitsplätze hierzulande. Wenn die Europäer Zölle erheben, werden die Chinesen dasselbe tun. Protektionismus hat noch nie funktioniert.
Im Herbst kommt die nächste Tarifrunde auf Sie zu. Laut einer Umfrage der IG Metall sehen die Beschäftigten die Unternehmen in der Lage, dass sie sich Lohnzuwächse leisten können. Sehen Sie das auch so?
Jemand, der in der Produktion arbeitet, weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, kann das gar nicht beurteilen. Wer es dagegen genau weiß, ist die IG Metall, deren Vertreter in den Aufsichtsräten sitzen. Sie wissen, dass die Industrie noch lange nicht wieder auf dem Niveau von 2018 angekommen ist. Die Kosten liegen aber weit über dem Stand von damals.
Mehr als ein Inflationsausgleich ist also nicht drin?
Wenn wir die Forderungen die Arbeitnehmer kennen, werden wir beraten. Im Moment ist die Lage in den meisten Unternehmen ziemlich schlecht, aber wir sehen natürlich auch die Bedürfnisse unserer Beschäftigten. Ich finde außerdem, dass wir auch eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Wenn in der Metall- und Elektro-Industrie das hohe Lohnniveau immer weiter zu stark steigt, dann geht die Schere bei der Entlohnung weiter auseinander. Wir brauchen auch Altenpfleger, Erzieher im Kindergarten, Verkäuferinnen oder Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Diese Branchen finden niemanden.
Würde ein höherer Mindestlohn helfen?
Ich bin nicht gegen einen höheren Mindestlohn. Es ist aber nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers, den Mindestlohn vorzuschlagen, sondern der Mindestlohnkommission. Da hat er sich rauszuhalten. Eine Einschränkung sollten wir dringend einführen: Um junge Leute in die Ausbildung zu bringen, sollte es den Mindestlohn erst ab 27 Jahren geben.
Wie bitte? Weniger Geld soll ein Anreiz für eine Ausbildung sein?
Die Ausbildungsvergütung in der Metall- und Elektro-Industrie liegt im ersten Lehrjahr bei über 1.000 Euro. Wer statt der Ausbildung einen Job zum Mindestlohn macht, hat mehr Geld – aber auf Dauer keine Perspektive. In Deutschland haben 2,9 Millionen Menschen unter 35 keine Ausbildung. Das ist eine Katastrophe.
Warum bezahlen Sie den Azubis dann nicht mehr?
Wir können die Ausbildungsvergütung nicht einfach verdoppeln. Es gibt leider viele junge Menschen, die drei, vier Ausbildungen angefangen und sie abgebrochen haben. Und zu viele verlassen ohne Abschluss die Schule: fast 55.000 junge Menschen jedes Jahr, das kann ein hochentwickeltes Land wie Deutschland nicht akzeptieren.
Gerade bei Jüngeren gibt es einen Trend zu kürzeren Arbeitszeiten. Die IG Metall hat die Vier-Tage-Woche auf den Tisch gebracht. Wird das ein Thema in der Tarifrunde?
Ich glaube nicht. Wir haben mit der 35-Stunden-Woche schon eine geringe Arbeitszeit, eigentlich müssten wir viel mehr arbeiten. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn jemand seine 35 Stunden an vier Tagen arbeiten würde. Das geht im Moment nicht, weil es das Arbeitszeitgesetz faktisch wegen der Ruhezeiten verbietet. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, dass wir eine Zweiklassengesellschaft schaffen: Ein Bandarbeiter oder eine Krankenpflegerin können nicht im mobilen Arbeiten sein.
Wäre in solchen Jobs die Vier-Tage-Woche ein Anreiz, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen?
Sicher, wenn man die Arbeitszeit nicht absenkt, sondern anders verteilt. Denn jede Stunde zählt, um den Wohlstand zu erhalten. Aber bei Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beißen Sie auf Granit, wenn Sie ein neues Arbeitszeitgesetz fordern. Wir brauchen die Vertrauensarbeitszeit – er will eine hundertprozentige Arbeitszeiterfassung. Dabei verstößt jeder, der am Abend nochmal in seine E-Mails sieht, gegen das Gesetz. Das ist doch ein Witz.
Aktuell wird das Ende des Verbrennerverbot in der EU diskutiert. Die CDU hatte im Europawahlkampf damit geworben. Wie stellen Sie sich das vor?
Brüssel muss die Fakten erkennen. Wenn hier in Berlin plötzlich alle Autos Elektrofahrzeuge wären – wo sollen denn Hunderttausende Ladestationen gebaut werden? Wir brauchen eine Menge grünen Strom, aber die Genehmigungszeiten für Windkraftanlagen dauern ewig. Und man muss klar sagen: E-Autos sind viel zu teuer.
Soll man es also ganz lassen mit der Elektromobilität?
Ich bin nicht dagegen, dass man E-Autos baut und verkauft, wir fahren selbst eins. Aber ich sehe die Probleme in der Praxis: Auf einer Autobahnraststätte mit zehn Ladestationen können zehn Autos in 25 Minuten laden. An der Tankstelle daneben tanken in der gleichen Zeit 85 Autos. 85 Ladestationen an einer Raststätte – das geht nicht. Deswegen bin ich für Technologieoffenheit und gegen die ideologische Festlegung, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch E-Fahrzeuge gibt.
China ist schon weiter bei der Elektromobilität. Setzt Deutschland mit dem Verbrenner auf eine Technologie, von der man sich international verabschiedet?
Die chinesischen Hersteller sind weiter, weil sie keine so guten Verbrennungsmotoren bauen können. Aber ein Verbot gibt es dort nicht. Und wenn in den USA im November Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird – was ich befürchte – dann wird es auch dort kein Verbot geben.
Die Idee dahinter war ja, dass Europa 2045 klimaneutral werden soll. Wie kann das trotzdem funktionieren?
Ich glaube nicht wirklich, dass das gelingt. Natürlich bin ich für Klimaschutz und sehe die Folgen des Klimawandels. Aber es passiert relativ wenig in China, Indien und den USA, die zusammen für 65 Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit stehen. Zu glauben, dass wir dieses globale Thema über Datumsgrenzen regeln können, ist total naiv.
Genau das ist doch die Planbarkeit der Transformation, die Unternehmensverbände immer fordern.
Die ist doch kläglich gescheitert. Schon die Bundeskanzlerin wollte bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße bringen – ohne Erfolg. Man kann Anreize für klimafreundliche Technologien setzen, mit entsprechenden Subventionen. Der Inflation Reduction Act in den USA führt zu hohen Investitionen in klimafreundliche Technologien, das lockt auch deutsche Firmen an.
Wollen Sie wirklich mit mehr Subventionen die Staatsausgaben und die Verschuldung erhöhen?
Nein. Man muss die Mittel nur vernünftig umverteilen. Wieso bezahlen wir beispielsweise noch Entwicklungshilfe an Indien? Die fliegen zum Mond, das ist ein technisch hochentwickeltes Land. Die Diesel-Subventionen könnte man auch streichen, aber mit einer ausreichend langen Übergangsfrist. Es war ein Riesenfehler, das im Dezember für die Landwirte von einem Tag auf den anderen zu tun.
Sie stellen sich an diesem Freitag zur Wiederwahl als Gesamtmetall-Präsident, obwohl sie nicht mehr Chef eines Metallunternehmens sind. Gab es dagegen Widerstände?
Im Gegenteil: Ich wurde gefragt, ob ich weitermache. Da ich jetzt als Senior Adviser für eine Unternehmensberatung tätig bin, sehe ich noch mehr metallverarbeitende Betriebe als früher. Ich werde auch sicher noch die eine oder andere Aufsichtsratstätigkeit übernehmen.