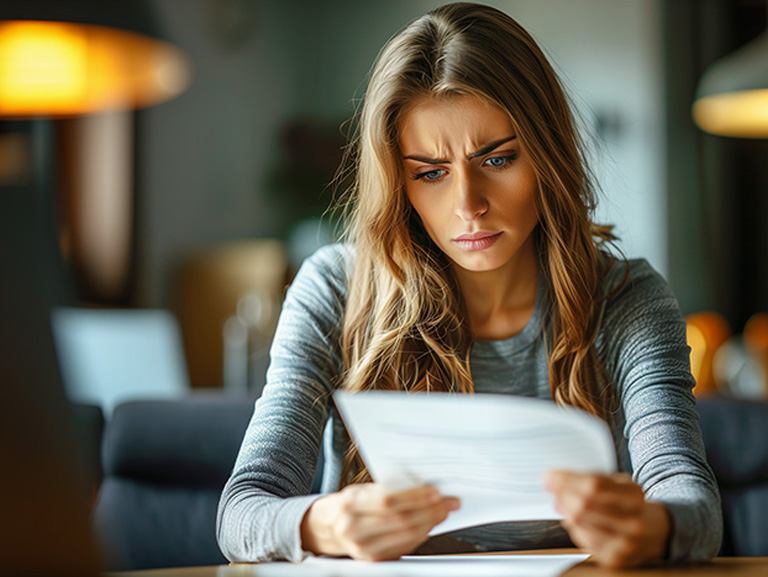Ist Deutschland zu bequem geworden? Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf im Interview mit t-online über die dringenden Aufgaben der Ampel und unbequeme Wahrheiten für die Deutschen.
Herr Wolf, Deutschland ist wirtschaftlich wieder der „kranke Mann Europas“. An welchen Gebrechen leiden wir?
Deutschland hat gleich mehrere Krankheiten. Es fängt an bei den teuren Energiepreisen, geht weiter bei der Bürokratie und den ewig langen Genehmigungsverfahren und endet mit den hohen Lohn- und Lohnnebenkosten sowie der Unternehmenssteuer. In der Summe macht das Deutschland als Standort unattraktiv. Kein Wunder, dass der Internationale Währungsfonds uns als einzigem großem Industrieland einen Abschwung prognostiziert.
Die Corona-Pandemie und auch die ersten Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die deutsche Wirtschaft relativ gut verkraftet. Warum haben wir jetzt das Nachsehen?
Das sehe ich anders. Die heutigen Probleme der deutschen Wirtschaft beginnen viel früher, weit vor Corona.
Wann denn?
Ende 2018 und dann im Jahr 2019 mit der Industrierezession. Damals schon hat etwa die Autoindustrie erste Rückgänge verzeichnet. 2020 dann, mit der Pandemie, ist die Anzahl der produzierten Fahrzeuge weltweit von 90 auf 72 Millionen extrem eingebrochen. Zum Vergleich: Wenn es alles gut geht, laufen dieses Jahr vielleicht 80 Millionen Fahrzeuge vom Band – das sind also immer noch 10 Millionen Autos weniger als 2018. Auch die Materialpreise sind noch nicht wieder aufs Vorkrisenniveau gesunken. Das spüren vor allem kleine Unternehmen. Der Mittelstand hat die Krise noch nicht verkraftet. Und jetzt kommen noch weitere Belastungen dazu.
Sie beklagen vor allem die Rahmenbedingungen in Deutschland, die Regulierung. Aber kann es nicht sein, dass die Probleme auch woanders liegen – ist unser Land nicht einfach zu satt?
Wir sind eine bequeme Wohlstandsgesellschaft geworden. Deshalb fehlt gerade auch manchen jungen Menschen der Biss. Sicher, es gibt auch viele Menschen, die motiviert sind, die sich etwas erarbeiten wollen. Doch das Gros der Deutschen ist in Zeiten des blühenden Wohlstands aufgewachsen und betrachtet diesen vielleicht als selbstverständlich – was er aber nicht ist. Da habe ich in Indien und China eine andere Mentalität erlebt.
Was genau meinen Sie damit?
Derzeit ist bei uns oft die Rede von Work-Life-Balance. Dabei wird impliziert, dass Arbeit das Schlechte und Freizeit das Gute ist. Das ist so natürlich albern. Was wir stattdessen brauchen, sind klare Worte, wie einst von Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 ausrief, oder vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog mit seiner „Ruck-Rede“. Doch dafür muss jemand die Führung übernehmen und die Gesellschaft mitnehmen.
Eigentlich eine Aufgabe für den Bundeskanzler.
In der Tat ist das seine Aufgabe und sie ist aktuell wichtiger denn je. Ich habe leider den Eindruck, dass vielen die Dramatik der wirtschaftlichen Lage nicht bewusst ist. Dabei muss die Ruck-Mentalität von der Regierung ausgehen. Da muss jetzt was kommen. Falls die Ampelregierung bei ihrer nächsten Kabinettsklausur in Meseberg Ende August nicht zu wirklich überzeugenden Beschlüssen kommt, droht uns eine heftige Deindustrialisierung. Davon hängt das Ansehen der Ampelkoalition ab.
Was würde Sie denn überzeugen?
Es bedarf jetzt kurzfristiger Impulse, die der Wirtschaft noch dieses Jahr helfen – und dann braucht Deutschland eine echte Agenda 2030. Damit meine ich ein umfassendes Modernisierungspaket, das die Rahmenbedingungen in unserem Land grundlegend verbessert, das dafür sorgt, dass Firmen wieder gern bei uns investieren und hier Arbeitsplätze schaffen.
Finanzminister Christian Lindner hat dafür eine Steuerreform ins Spiel gebracht.
Ja, und das ist gut so. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die Ampel macht nicht alles verkehrt. Dieses Wachstumschancengesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, …
… wurde aber gerade durch ein Veto der Familienministerin vorerst gestoppt.
Was immer da vorgegangen ist: Das geht so nicht. Es ist schlicht ein verheerendes Signal, wenn die Ampelkoalition so streitet, während die Unternehmen dringend Entlastungen brauchen und der Standort Deutschland wieder attraktiv für Investitionen werden muss. Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er bis zur Kabinettsklausur in Meseberg eine Einigung herbeiführt, damit das Gesetz schnellstmöglich in Kraft treten kann.
Der andere Ansatz, den die Bundesregierung verfolgt, sind Milliardenförderungen für Unternehmen, die nach Deutschland kommen, etwa die Chiphersteller Intel und TSCM. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass dies der richtige Weg ist. Für einzelne Konzerne oder auch Branchen mag das hilfreich sein und ich verstehe auch, dass wir gerade bei Chipfabriken von China unabhängig werden wollen. Unser aller Ziel muss es doch aber sein, dass die Unternehmen aus aller Welt in Deutschland investieren wollen! Dazu müssen wir das Problem der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes an der Wurzel packen – und das tun wir nicht, indem wir in einen Subventionswettbewerb mit den Amerikanern eintreten. Allen Unternehmen muss die Möglichkeit gegeben werden, unter guten Bedingungen zu arbeiten.
Eine der Bedingungen, die Sie bereits angesprochen haben, sind die hohen Energiekosten. Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt einen niedrigen Industriestrompreis vor. Was halten Sie von dieser Idee?
Wir brauchen günstigere Energiepreise, keine Frage, aber Habecks Mittel allein ist das falsche, wenn ein Industriestrompreis nicht bei den Mittelständlern und vielen Familienunternehmen unserer Industrie ankommt.
Was wäre denn besser als der Industriestrompreis?
Ein richtiger Hebel ist die Stromsteuer. Das würde schon eine Veränderung bedeuten. Da kann der Staat leicht etwas ändern und sie auf das europäisch festgelegte Mindestmaß senken. Das würde eine deutliche Veränderung bedeuten, denn die deutsche Stromsteuer ist 31-mal so hoch wie das Mindestmaß. Mittel- und langfristig hilft letztlich nur eine Ausweitung des Stromangebots.
Absehbar soll nun auch noch der CO2-Preis deutlich steigen, eine weitere Belastung für viele Firmen. Die Regierung will damit den Klima- und Transformationsfonds finanzieren. Ist das Ihrer Meinung nach die richtige Abwägung?
Klimaschutz ist wichtig, keine Frage. Aber aktuell halte ich eine zusätzliche Belastung der Industrie für den falschen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Der grüne Teil der Ampelkoalition denkt da zu ideologisch, davon müssen wir weg und stattdessen pragmatische Lösungen finden.
Wenn Ihnen Klimaschutz wichtig ist, warum ist der CO2-Preis – ein marktwirtschaftliches Instrument – dann grüne Ideologie?
Kein Unternehmer diskutiert mehr darüber, dass etwas für den Klimaschutz getan werden muss. Und wenn die Ampelkoalition dies über den CO2-Preis machen möchte, dann aber bitte auch konsequent. Dann müssen alle anderen Auflagen und Instrumente gestrichen werden.
Wie meinen Sie das?
Wenn der CO2-Preis nur obendrauf kommt, ist es eine als Instrument getarnte Zusatzsteuer. Und die Politik soll bitte Abschied davon nehmen, festlegen zu wollen, welche Produkte am Ende des Strukturwandels übrigbleiben sollen. Das entscheiden nämlich unsere Kunden weltweit. Wenn aber der Staat vorschreiben will, wie die Unternehmen diese Ziele erreichen sollen, dann empfinde ich das als tiefes Misstrauen. Das stört mich, denn in der Sozialen Marktwirtschaft herrscht schließlich Freiheit des Marktes verbunden mit einem sozialen Ausgleich.
Neben der teuren Energie blicken viele Unternehmer vor allem wegen des Fachkräftemangels besorgt in die Zukunft. Dabei verschenkt Deutschland viel Potenzial: 50.000 junge Menschen verlassen jährlich ohne Abschluss die Schule, viele Mütter bleiben daheim oder arbeiten in Teilzeit, weil es keine Kitaplätze gibt. Wie lassen sich diese Menschen für den Arbeitsmarkt gewinnen?
Was die jährlich 50.000 jungen Menschen ohne Schulabschluss angeht, ist die Politik in der Pflicht. Was die Betreuung angeht, braucht es ein höheres Maß an Flexibilität. Die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass das geht. Konkret: Mehr Homeoffice ist häufig möglich. Das hilft am Ende auch Eltern, die kleine Kinder zu Hause haben und ihre Arbeitszeit damit besser einteilen und so leichter am Arbeitsleben teilnehmen können. Und das wiederum ist nicht nur für die Wirtschaft wichtig, sondern auch für die einzelnen Menschen selbst.
Warum?
Arbeit ist soziale Teilhabe, sie kann sehr erfüllend sein. Wir müssen die Menschen dazu bringen, mehr zu arbeiten. Sonst riskieren wir nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch die Zufriedenheit der Gesellschaft.
Experten sagen: Dafür brauchen wir auch mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Zugleich scheinen angesichts des AfD-Höhenflugs immer mehr Deutsche gegen mehr Zuwanderung zu sein. Wie passt das zusammen?
Da müssen wir sauber trennen. Für mich hat der enorme Zuwachs der AfD vor allem mit der schlechten Politik der Ampelregierung zu tun und weniger mit dem diffusen Gefühl, dass zu viele Menschen aus dem Ausland zu uns kommen. Die AfD ist für meine Begriffe vor allem eine Protestpartei. Mein Eindruck ist, dass die allermeisten durchaus wissen, dass es ohne Fachkräfte-Zuwanderung nicht gehen wird – zumal, wenn wir parallel Debatten darüber führen, dass manche Leute sogar eher weniger arbeiten wollen als bislang.
Sie sprechen die Diskussion um die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich an.
Weniger arbeiten fürs gleiche Geld? Das geht nicht. So machen wir unseren Standort nicht stark, gerade auch wegen des großen Fachkräfteproblems. Tatsächlich brauchen wir das Gegenteil: Die Menschen müssen wieder mehr arbeiten. Und übrigens auch länger, so wie es jüngst die Wirtschaftsweise Veronika Grimm vorgeschlagen hat, …
… die dafür plädiert, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln.
Ja. Das ist ein sehr guter Vorstoß. Andere Länder machen das schon längst. Und auch wir werden nur so unseren Wohlstand dauerhaft sichern.
Ist das Ihrer Ansicht nach der einzige Hebel, um das Rentensystem zu retten?
Es ist jedenfalls der wichtigste. Ich habe es schon öfter gesagt: Mittelfristig muss das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden. Zumindest in den allermeisten Berufen.
Was heißt „mittelfristig“?
Ich denke, dass wir um diese Anhebung in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht herumkommen.
Erschienen am 17. August 2023.