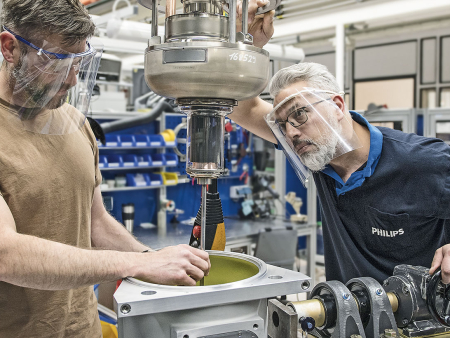Interview von Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf mit der WELT:
In fünf Wochen ist Bundestagswahl. Wie elektrisiert sind Sie bislang vom Wahlkampf?
Das wird eine absolute Richtungswahl. Das Land ist in der schwersten Wirtschaftskrise seit 75 Jahren. Wir brauchen mehrere Jahre Wachstum von zweieinhalb bis drei Prozent, um wieder den Wachstumspfad zu erreichen, den wir bis 2018 hatten. Ehrlich gesagt: Die deutsche Wirtschaft ist in einer dramatischen Lage. Die FDP hat das als erstes erkannt. Das Wirtschaftswende-Papier von Christian Lindner trifft es auf den Punkt. Es könnte eine Blaupause sein für eine neue Regierung. Deswegen hoffe ich, dass die FDP sich berappelt, ins Parlament kommt und Teil der neuen Regierung wird.
Eine eher brüchige Hoffnung.
Um es klar zu sagen: Wenn eine neue Koalition keinen Politikwechsel hinbekommt, der uns wieder auf die Spur bringt, erwarte ich, dass wir in vier Jahren eine extrem starke AfD mit vielleicht 30 oder 35 Prozent haben.
Denken Sie, dass die anderen Parteien auf den Wirtschaftskurs der FDP umschwenken werden?
Unnötige Gesetze wie das Lieferkettengesetz oder die Datenschutzgrundverordnung müssen in Nullkommanichts weg. Wir geben Geld aus ohne Ende, 70 Milliarden Euro in der deutschen Industrie nur für Bürokratie. Auch eine Unternehmenssteuerreform, niedrigere Netzentgelte und die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent sind überfällig. Arbeit muss sich wieder mehr lohnen. Nur fehlt mir der Glaube, dass eine Koalition unter Beteiligung von SPD das umsetzt. Und mit den Grünen wird es gleich zweimal schwerer, sie sind unglaublich ideologisch geprägt.
Die SPD hat im Zuge des Wahlkampfs die Bezugszeit des Kurzarbeitergelds auf zwei Jahre verdoppelt. Ist das der richtige Weg?
Ich halte es für richtig. Wir haben mit dem Kurzarbeitergeld gute Erfahrungen gemacht in den vorherigen Krisen. Trotzdem ist es ein taktisches Manöver des Kanzlers. Noch im Sommer hat Scholz sich hingestellt und gesagt, wir hätten keine Wirtschaftskrise.
Die Entscheidung zur Verdopplung wurde gegen den Rat vieler Experten getroffen. Sebastian Dettmer beispielsweise, Chef von Stepstone (gehört wie WELT AM SONNTAG zu Axel Springer), sagt, man halte damit teilweise sterbende Unternehmen künstlich am Leben.
Das sehe ich anders. Denn es gibt viele Unternehmen, die Beschäftigte halten wollen und parallel dazu Transformationsprogramme aufsetzen und den Menschen Möglichkeiten anbieten, sich weiterzubilden, sich zu verändern und in andere Bereiche zu gehen, ohne arbeitslos zu werden.
Dazu gibt es aber keinerlei Verpflichtung. Findet das tatsächlich statt?
Der Sinn von Kurzarbeit ist es ja, konjunkturelle Dellen zu überstehen, ohne Stellen abbauen zu müssen, aber nicht den notwendigen Strukturwandel zu verschleppen. Die IG Metall will Jobwechsel über sogenannte Drehscheiben-Modelle ermöglichen – allerdings nur innerhalb der Branche, um die Einkommen abzusichern. Das wird nicht funktionieren. Die Industrie wird in den nächsten fünf Jahren noch deutlich mehr Arbeitsplätze verlieren. Schon jetzt ist der Stellenabbau real, seit zehn Monaten in Folge. Aktuell arbeiten in der Metall- und Elektroindustrie noch 3,91 Millionen Beschäftigte, gleichzeitig zählt die Bundesagentur für Arbeit 157.000 Arbeitslose mit qualifizierten Metall- und Elektroberufen. In anderen Bereichen aber herrscht weiterhin massiver Personalmangel Arbeitsmarktdrehscheiben funktionieren nur, wenn sie branchenoffen gestaltet sind.
Wie realistisch ist es, dass Zehntausende Metallarbeiter plötzlich Pfleger werden oder zu ganz anderen Löhnen in der Gastronomie arbeiten?
Einen 55-jährigen Metallarbeiter werden wir eher nicht dazu bringen, dass er auf Altenpfleger umschult. Und die jungen Leute mit Ende 20 oder Anfang 30 müssen wir qualifizieren, denn in bestimmten M+E-Berufsgruppen gibt es noch 130.000 offene Stellen und insgesamt 12.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. In MINT-Berufen allgemein gibt es trotz Rezession und Strukturkrise sogar 185.000 Stellen, für die es keine passenden Bewerber in Deutschland gibt.
Es ist eine Frage der Vermittlung, wenn man sagt: in deinem jetzigen Bereich hast du vielleicht noch eine Zukunft von drei oder vier Jahren. Wenn du in einen anderen Bereich wechselst, verdienst du zwar weniger, hast aber bessere Entwicklungsperspektiven.
Die Politik verspricht, dass durch Kurzarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann. Sie sagen aber, dass ein Teil der Mitarbeiter keine Perspektive mehr hat?
Die Beschäftigung in der Metallindustrie ist in den Jahren 2023 und 2024 gesunken, das wird sich ohne eine Wirtschaftswende auch 2025 fortsetzen. Wir sind bei einer Auftragsauslastung von durchschnittlich 75 Prozent. Das heißt, wir können die Arbeitsplätze nicht erhalten. Dafür reicht der Umsatz nicht aus. Also müssen wir an der Kostenschraube drehen.
Wenn Volkswagen jeden vierten Arbeitsplatz in Deutschland streicht und bei Zulieferern wie Bosch und ZF Zehntausende Jobs wegfallen: Was bleibt noch übrig von der deutschen Industrie?
Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Sehr viele Unternehmen investieren nicht mehr in Deutschland, bauen hier Arbeitsplätze und Produktion ab und stattdessen im Ausland auf. Volkswagen wird, denke ich, auch in fünf Jahren noch zwischen neun und zehn Millionen Autos pro Jahr bauen – aber in anderen Ländern. Es ist die Aufgabe der Politik, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, damit deutsche und ausländische Unternehmen hier investieren und Arbeitsplätze erhalten. Wir haben mit der IG Metall einen Tarifvertrag abgeschlossen, der den Standort stärkt. Es gibt darin Raum für individuelle Regelungen, mit denen Unternehmen, denen schlecht geht, Personalkosten reduzieren können. Den Mitarbeitern ist es wichtig, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Die Veränderungsbereitschaft und die Mobilitätsbereitschaft der Menschen haben aus meiner Sicht sehr stark abgenommen. Die meisten wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Es wird aber Veränderungen geben.
Ein wesentlicher Punkt bei den Kosten sind die Lohnnebenkosten. Robert Habeck hat vorgeschlagen, Sozialabgaben auch auf Kapitaleinkünfte zu erheben. Dadurch würden die Kosten für die Unternehmen womöglich sinken. Finden Sie das gut?
Dieser Vorschlag ist aberwitzig. Man muss die Sozialabgaben insgesamt senken. Also nicht nach neuen Einnahmequellen zusätzlich zu einer Abgabenquote von 43 Prozent suchen, sondern die Belastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf 40 Prozent verringern. Der logische Ansatzpunkt bei den Sozialabgaben ist der Lohn, weil die Menschen krankenversichert sind, für Rente und Pflege einzahlen. Mir fehlt die Fantasie, wie man diese Logik auf Kapitalerträge übertragen soll.
Welche Sozialleistungen sollen denn konkret eingeschränkt werden?
Man kann im Verwaltungsbereich sparen. Wenn die Sozialversicherungsträger besser zusammenarbeiten und zum Beispiel Daten miteinander abgleichen würden, können sie massiv Kosten einsparen. Personalstruktur und -umfang ist auch ein wichtiger Punkt, in der Agentur für Arbeit ist viel noch verkrustet und bürokratisch. Künftig kann man auch vieles über künstliche Intelligenz abwickeln und wird weniger Leute brauchen.
Aber das reicht doch nicht, um den Beitragsanstieg zu stoppen.
Wenn es nicht reicht, wird der Staat eintreten müssen. Und zwar nicht mit höheren Steuern, sondern indem man sich die gesamten staatlichen Ausgaben ansieht. Als Vorstandschef hatte ich meinen Bereichsleitern genaue Vorgaben gemacht, wie viele Millionen sie jeweils einsparen müssen. So sollte es auch der Bundeskanzler bei seinen Ministern machen. Die Ampelkoalition hat in ihren drei Jahren allein in den Bundesministerien und im Kanzleramt mehr als 2000 neue Mitarbeiter eingestellt. Wenn die nötig waren, stellt sich die Frage, wie die Regierung vorher funktioniert hat.
Wo würden Sie denn sparen?
Wir haben einen total aufgeblähten Sozialetat. Allein für Bürgergeld geben wir über 37 Milliarden Euro aus. Da stelle ich mir die Frage, ob das sein muss. Gerhard Schröder hat mit der Agenda 2010 massiv Sozialausgaben eingespart. Jetzt sind wir wieder in einer ganz ähnlichen Situation wie damals. Der einzige Unterschied ist, dass es damals fünf Millionen Arbeitslose gab. Wir brauchen eine komplette Reform der Sozialhaushalte. Ich glaube auch, dass wir viel im Bereich auch Entwicklungshilfe einsparen können. Indien fliegt zum Mond – wieso sollten wir Indien Entwicklungshilfe zahlen?
Das Einsparpotenzial beim Bürgergeld reicht doch bei weitem nicht, um den Investitionsstau aufzuwiegen.
Es gibt sicher noch viele andere Bereiche, in denen man sparen kann. Die Steuereinnahmen haben sich zwischen 2015 und 2024 fast verdoppelt. Das zeigt doch, dass Deutschland ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem hat. Manchmal fehlt schlicht die Bereitschaft zum Sparen. Die muss ich als Chef aber einfordern, wenn gespart werden muss.
Auch der Krankenstand wird zum Politikum. Deutschland liegt über dem europäischen Schnitt bei den Fehltagen. Was wäre Ihre Lösung, sind Sie für Karenztage?
Das hatten wir schon einmal, und es wurde dann wieder abgeschafft. Damals sollten die Karenztage das Problem der Fehlzeiten am Freitag und Montag lösen – da sollte es kein Geld mehr geben. Das Problem gibt es immer noch, auch an Brückentagen. Aber ich glaube, man muss das differenziert betrachten, um nicht die Falschen zu treffen.
Sie haben vorhin die Wachstumszahlen erwähnt. Ein grundsätzliches Problem dabei ist, dass die Produktivität nicht steigt in Deutschland und uns die USA abgehängt haben, weil dort viel mehr in KI und Robotik investiert wird. Wie könnte man die Produktivität wieder steigern?
Die Wirtschaft und der Staat müssen massiv in die Digitalisierung investieren. Die Betriebe sind zum Teil digitalisiert, brauchen jetzt aber viel mehr KI. Viele Arbeitsschritte, die heute von Menschen durchgeführt werden, können bereits von KI übernommen, das gilt in der Produktion und in der Verwaltung. Beim Vergleich mit den USA muss man sich aber auch die Ausgangslage ansehen. Die Automatisierung und Effizienz von Fabriken in den USA ist deutlich schlechter als in Deutschland. Das Potenzial für eine Steigerung der Produktivität ist dort deswegen größer, weil deutsche Unternehmen ihre Prozesse schon sehr effizient gestaltet haben. Gerade in der Metall- und Elektroindustrie gibt es viele Bereiche, die nicht mehr effizienter werden können, weil sie es schon sind.