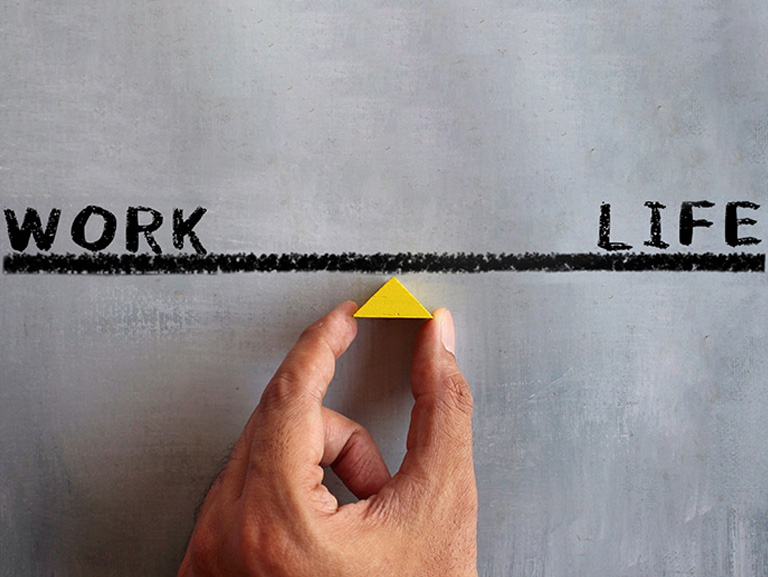Die Tarifautonomie steht immer wieder im Fokus politischer Debatten. Aus einer historischen Perspektive heraus und mit aktuellen Beispielen wird gezeigt, welchen Angriffen das Erfolgsmodell Tarifautonomie in über 100 Jahren ausgesetzt war und noch heute ausgesetzt ist. Auch stellen die Autoren die Bedeutung der Tarifautonomie als tragende Säule der Sozialen Marktwirtschaft heraus und zeigen, wie sie über die Zeit hinweg legitimiert und von Politik und Gesellschaft als legitime Institution angesehen wurde. Dabei wird eine juristische Perspektive mit einer ökonomisch-sozialwissenschaftlichen Sichtweise verbunden.
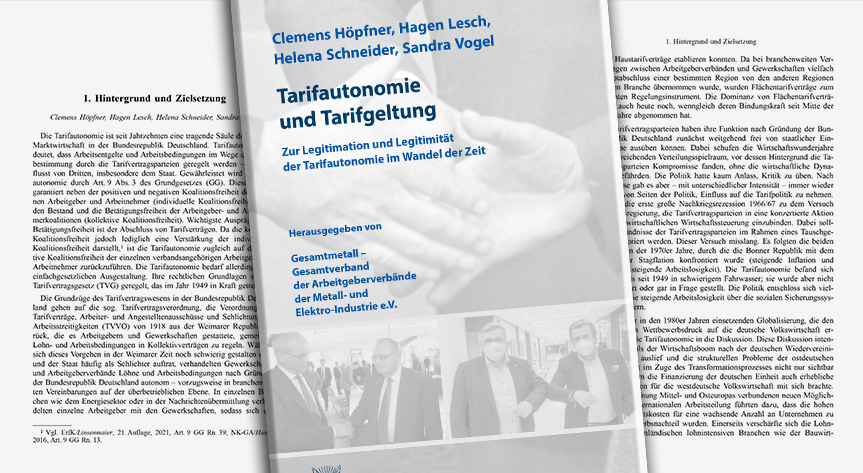
Besonders umstritten ist, wie die Tarifautonomie gestärkt und wie die Tarifbindung erhöht werden kann. Unser Grundgesetz ist da eindeutig. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Verbände und Gewerkschaften regeln selbstbestimmt Tarife und Arbeitsbedingungen. Der Staat hat sich herauszuhalten. Dieses Prinzip mit Verfassungsrang wird trotz seiner langen und erfolgreichen Geschichte häufig angegriffen.
Die Tarifautonomie bewirkt, dass Arbeitsbedingungen nicht individuell durch den einzelnen Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber verhandelt werden. Vielmehr verhandelt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber oder einem Arbeitgeberverband. Damit können Arbeitsbedingungen fair und austariert geregelt werden. Die Tarifautonomie garantiert den Arbeitnehmern einerseits gute Arbeitsbedingungen, die die Arbeitgeber andererseits nicht überlasten und die Arbeitgeberattraktivität steigern. Gleichzeitig sorgt der Flächentarifvertrag, der nicht mit dem einzelnen Arbeitgeber, sondern dem jeweiligen Arbeitgeberverband einer Branche verhandelt wird, dafür, dass Verteilungskonflikte aus den Betrieben herausgehalten werden und dass innerhalb der Wertschöpfungskette weitgehend ohne Störungen produziert werden kann.
Für eine soziale Balance in der Gesellschaft
Man kann mit Recht sagen, dass sich diese Art, soziale Balance zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu schaffen, in Deutschland bewährt hat, und das bereits seit über 100 Jahren. Die Tarifautonomie wurde 1918 mit dem Stinnes-Legien-Abkommen institutionalisiert, 1933 von den Nationalsozialisten abgeschafft, 1949 in Westdeutschland wiederbelebt, zudem verfassungsrechtlich garantiert und schließlich 1990 auf Ostdeutschland ausgeweitet.
Seit Jahrzehnten trägt sie damit zum sozialen Ausgleich in einer freien Marktwirtschaft bei und ist so zu einer tragenden Säule der Sozialen Marktwirtschaft, des äußerst erfolgreichen deutschen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells, geworden.
Trotzdem wurde und wird immer wieder kontrovers über die Tarifautonomie debattiert. Die Kritik entzündet sich beispielsweise an ausufernden Tarifkonflikten und und den schweren Schäden, die daraus auch für Dritte entstehen, ihren betriebs- und volkswirtschaftlichen Folgen sowie der Komplexität von Tarifverträgen.
Welche Rolle soll der Staat spielen?
Aktuell wird insbesondere die abnehmende Tarifbindung, d.h. die sinkenden Mitgliederzahlen bei Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, beklagt. Daher wird immer häufiger gefragt: Muss der Staat nicht sogar eingreifen, wenn in einer Branche nur eine geringe Tarifbindung besteht oder umgekehrt Tarifkonflikte ausarten, wie zum Beispiel zuletzt im Bahnstreik kurz vor der Bundestagswahl? Oder hat er sich dennoch komplett herauszuhalten? Welche Eingriffe sind möglicherweise sinnvoll?
In der Analyse zeigt sich, dass Maßnahmen beispielsweise, die lediglich eine Ausweitung der Tarifgeltung bezwecken, wie die Ausweitung der Allgemeinverbindlicherklärung, die Probleme der rückläufigen Tarifbindung nicht lösen und sogar zur Erosion der Tarifautonomie beitragen, weil sie für die vom Tarifvertrag erfassten Arbeitnehmer jeden Anreiz beseitigen, in die Gewerkschaft einzutreten. Zur Stärkung der Tarifautonomie muss vielmehr auf Instrumente gesetzt werden, die die Tarifbindung attraktiv machen, ohne dabei die negative Koalitionsfreiheit einzuschränken.
Letztlich ist aber festzuhalten, dass trotz wiederholter Versuche, die Tarifautonomie der Tarifvertragsparteien einzuschränken, sich der Kern der Tarifautonomie bis heute behauptet hat.
Das Buch, das vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall herausgegeben wurde, können Sie hier bestellen.