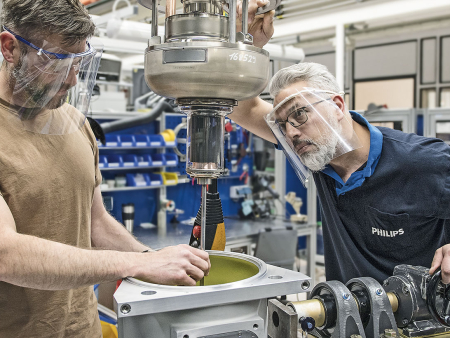Was die Politik von Tarifrunden lernen kann, erklärt Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf im Interview mit der FAZ:
Herr Wolf, als Tarifpolitiker, Manager und Managementberater sind Sie ein Profi für komplexe Verhandlungssituationen. Was würden Sie Union und SPD raten – wie sollten sie den Prozess der Koalitionsverhandlungen aufsetzen, damit er gut funktioniert?
Ganz wichtig ist, solche Prozesse im Voraus gut zu strukturieren und einen klaren, straffen Zeitplan vorzugeben. Bestimmte Themenblöcke in kleinere Facharbeitsgruppen auszulagern und da vorzuklären, ist ebenfalls ratsam. Allerdings dürfen diese nicht zu viel Eigenleben entwickeln. Sie arbeiten im vorab festgelegten Rahmen den Verhandlungsführern zu. Die wiederum müssen die fachliche Arbeit gut moderieren und auf das Ziel der angestrebten Gesamtlösung hinsteuern.
Was gibt es noch zu beachten?
Außerdem, auch das zeigt die Erfahrung aus vielen Tarifverhandlungen, ist es hilfreich, wenn beide Seiten zu Beginn gewisse rote Linien markieren. Die dürfen natürlich nicht willkürlich sein, sonst droht Totalblockade. Aber wenn die jeweils andere Seite ein Bild davon hat, wo die eigenen Tabuzonen beginnen, dann entsteht ein Verhandlungskorridor. Der ist am Anfang sehr weit. Begibt man sich dann hinein, rückt man sich Stück für Stück näher und steuert irgendwann auf das gemeinsame Ergebnis zu.
Tarifparteien sind letzten Endes zu einer Einigung verdammt. Politische Parteien können auch sagen: Soll doch jemand anders die Kompromisse schließen.
Wenn sich Tarifparteien einer Einigung komplett verweigern, gibt es am Ende keinen Tarifvertrag mehr. Unter den gegebenen Umständen würde ich sagen: Sollten Union und SPD jetzt keine Einigung hinkriegen, geht auch für sie mehr verloren als eine Chance auf gemeinsames Regieren. Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen es, bei allen Konflikten, als ihre Verpflichtung an, die Tarifautonomie zu wahren. Jetzt haben Union und SPD eine große Verpflichtung für unser demokratisches Gemeinwesen.
Roten Linien für den Verhandlungsprozess – welche schweben ihnen da vor?
Die erste liegt auf der Hand: Die Menschen erwarten eine schnelle, wirksame Regelung, um irreguläre Migration zu begrenzen und eine Befriedung dieses gesellschaftlichen Konflikts zu ermöglichen. Eine Regierung, die da nichts liefert, hätte versagt. Wir brauchen, zweitens, klare Schritte – nicht nur Worte – zum Rückbau überbordender Bürokratie. Digitalisierung und künstliche Intelligenz müssen endlich Chefsache werden, die Modernisierung unseres Staates darf kein politisches Anhängsel von irgendwas mehr sein, sondern das Thema ist ganz zentral. Drittens brauchen wir Steuererleichterungen für Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten. Ebenso nötig ist die Rückkehr zu einer Begrenzung der Sozialbeiträge auf 40 Prozent des Bruttolohns. Viertens muss die Bildungspolitik endlich liefern, was nur mit einer starken Rolle des Bundes gehen wird. Und, nicht zuletzt: Wir brauchen wieder eine vernünftige Energiepolitik und wettbewerbsfähige Strompreise.
Wie detailliert sollte ein Koalitionsvertrag sein, damit er der Regierung eine stabile Grundlage bietet?
Ich empfehle einen Koalitionsvertrag, der zu den wichtigsten Aufgaben klare, belastbare Grundaussagen trifft, sich aber nicht in Details verliert. Als Tarifparteien haben wir da einen Lernprozess hinter uns. Über Jahre wurden unsere Tarifverträge immer kleinteiliger. Aber das hat uns Kritik und Frust unserer Mitglieder eingebracht. Was nützt ein feinziselierter Kompromiss, wenn sich damit im Alltag nichts anfangen lässt, weil er zu kompliziert ist? Ich bin froh, dass wir uns in der Tarifrunde 2024 daran gemacht haben, Sachverhalte wieder möglichst klar und einfach zu regeln, und das in sehr gutem Einvernehmen mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner.
Ihre Vorschläge für rote Linien haben Sie gemacht. Glauben Sie, dass Friedrich Merz die ähnlich zieht?
Wenn ich mich an seinen Aussagen der Union im Wahlkampf orientiere, gibt es da viele Übereinstimmungen. Natürlich gehört beim Thema Sozialstaat auch eine Korrektur des Bürgergelds dazu. Das Gefühl, dass sich Arbeiten nicht mehr richtig lohnt, hat sich ja nicht zufällig gerade im Arbeitermilieu verbreitet, einer früheren SPD-Klientel. Das ist ähnlich wie mit der Migrationsfrage: Eine Regierung, die diesem Gefühl nicht die Grundlage entzieht, kann nicht erfolgreich sein.
Glauben Sie, dass man beim Bürgergeld sechs Milliarden Euro im Jahr einsparen kann, wie es Merz angekündigt hat?
Ja, das halte ich für realistisch. Und mit einer wirksameren Migrationspolitik gäbe es weniger Menschen, die vom Sozialstaat versorgt werden müssen, obwohl sie kein Bleiberecht haben. Und genauso halte ich es für plausibel, dass unter den heute vier Millionen arbeitsfähigen Menschen im Bürgergeld einige Prozent sind, die künftig arbeiten oder sich aus der Grundsicherung abmelden, wenn wieder klar ist, dass diese eine Hilfe für Menschen in Notlagen ist.
Wie finden Sie die politische Idee, der neuen Regierung noch schnell mit der alten Bundestagsmehrheit eine Grundgesetzänderung auf den Weg zu geben, damit sie mehr Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur machen kann?
Das kommt mir nicht richtig vor. Wenn in einer Firma schon ein neuer Geschäftsführer oder CEO bestellt ist, dann würde ein Vorgänger niemals kurz vor seinem Ausscheiden so weitreichende Entscheidungen treffen, jedenfalls nicht ohne dessen Zustimmung.
Der künftige CEO im Bundestag ist aber – so gesehen – die Linkspartei. Bei ihr liegt faktisch die Entscheidung, ob eine Zweidrittelmehrheit für Grundgesetzänderungen zustande kommt…
Okay, natürlich gibt’s an der Unternehmensspitze keine Linkspartei. Da stößt der Vergleich an Grenzen. Aber überzeugend finde ich diese Idee grundsätzlich trotzdem nicht, auch wenn ich den Finanzierungsbedarf der Bundeswehr voll und ganz anerkenne.
Sie hätte vielleicht den Vorzug, dass die Regierung nicht gleich Steuern erhöhen muss, um ihren ersten Etat zusammenzukriegen. Hat das nichts für sich?
Steuererhöhungen? Entschuldigung, wir brauchen Steuerentlastungen, sonst geht es mit unserer Industrie und dem Standort Deutschland weiter abwärts. Schauen Sie sich die Unternehmenssteuern in anderen Ländern an: Wo sie niedriger sind als bei uns, wird mehr investiert. Oder nehmen Sie die Einkommensteuer: Wie entscheidet sich wohl ein gesuchter IT-Spezialist aus Bangalore, wenn er zwischen 35 Prozent Steuersatz in der Schweiz, 30 Prozent in Amerika und 48 Prozent inklusive Soli in Deutschland wählen kann?
Aber woher kommt der Spielraum für Entlastungen, wenn nicht aus Schulden?
Mag sein, dass man mit zeitlich gestaffelten Reformschritten arbeiten muss. Auf jeden Fall müssen die Belastungen sinken und nicht steigen. Außerdem gibt es zum Beispiel beim Staat und seinen Behörden riesiges Einsparpotential. Es kann doch etwas nicht stimmen: Der öffentliche Dienst hat in den vergangenen Jahren hunderttausende Stellen aufgebaut, aber von besserer Leistung merken Bürger und Unternehmen wenig – sie erleben vor allem noch mehr Bürokratie. Immerhin lässt sich das jetzt gut ändern. Es erreichen so viele öffentlich Bedienstete das Ruhestandsalter, dass sich allein durch Verzicht auf Nachbesetzungen ein spürbarer Stellenabbau realisieren lässt.
Wer in Verhandlungen seine wichtigsten Punkte durchsetzen will, muss an anderer Stelle nachgeben. Was kann die Union der SPD aus Ihrer Sicht zugestehen – vielleicht 15 Euro Mindestlohn?
Auf keinen Fall! Und ich sage das, obwohl in unseren Tarifverträgen für die Metall- und Elektro-Industrie die untersten Lohngruppen über 15 Euro liegen. Aber was wäre die Folge? Es würde besonders Einzelhandel, Gastgewerbe, Handwerk und Dienstleistungen treffen. Ladensterben und Verödung der Innenstädte würden beschleunigt. Außerdem haben wir mehr als eine Million Langzeitarbeitslose, die dringend Einstiegschancen brauchen. 15 Euro Mindestlohn wären das Gegenteil einer Politik für Wirtschaftswachstum.
Aber was sollte die Union der SPD sonst anbieten, höhere Renten vielleicht?
Die SPD muss sich doch erst mal fragen, ob sie wirklich so weitermachen will wie bisher. Hält sie ihre bisherige Sozial- und Migrationspolitik etwa immer noch für ein Erfolgsrezept? Würde sie sich auf das besinnen, was die in Scharen zur AfD überlaufenen Arbeiter interessiert, dann wären auch in den Koalitionsverhandlungen manche Gegensätze kleiner. Meine Sympathie hat die SPD aber zum Beispiel dann, wenn sie sich für mehr Kitaplätze und gute Ganztagsbetreuung starkmacht. Das ist für uns der Schlüssel um mehr Frauen als gut Fachkräfte in gut bezahlter Vollzeitarbeit zu gewinnen.
Gibt es Forderungen, die Sie als Metallarbeitgeber gemeinsam mit der IG Metall vertreten könnten – denn die fänden politisch sicher besonderes Gehör?
In der Tat. Wir sind gerade in einem guten Austausch mit der IG Metall darüber. Es ist zu früh für Details, aber so viel ist klar: Unsere Industrie braucht dringend wettbewerbsfähige Energiepreise, ein besseres Investitionsklima und Technologieoffenheit im Klimaschutz. Diese Ziele können wir gemeinsam mit der IG Metall vertreten. Und wir werden in der Lage sein, das auch mit gemeinsam getragenen Vorschlägen zu unterfüttern.