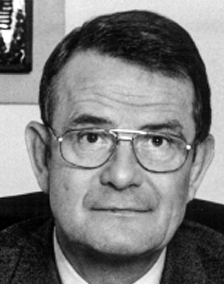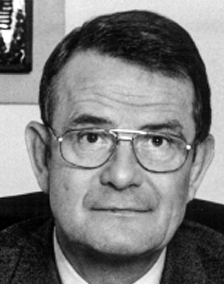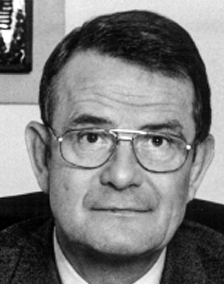Das 20. Jahrhundert gilt gemeinhin als „Jahrhundert der Verbände“ (Theodor Eschenburg). In diesem Sinne war der „Verband Deutscher Metallindustrieller“, bereits am 19. März 1890 gegründet, schon damals ein Vorreiter.
Die Gründung ging einher mit dem steilen wirtschaftlichen Aufstieg des Deutschen Reichs im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Entscheidende Impulse dazu lieferte die metallverarbeitende Industrie. Dabei kam es immer wieder zu sozialen Auseinandersetzungen. Um sich gegen Streiks wirksamer wehren zu können, wurden deshalb in vielen Industriezweigen regionale Arbeitgeberverbände gegründet.
Die Politik plante jedoch, Streiks und Aussperrungen durch Einführung einer staatlichen Zwangsschlichtung zu beenden – und damit in die Gestaltung der Arbeitsbedingungen hineinzuregieren. Diesem Ansinnen wollten die metallindustriellen Arbeitgeber durch die Gründung eines Spitzenverbandes begegnen. Sie wollten zeigen, dass eine straff koordinierte Streikabwehr den Eingriff des Staates überflüssig macht. Hinzu kommt, dass auf Seiten der Gewerkschaften, die sich nach dem Auslaufen des Sozialistengesetzes 1890 wieder etablieren durften, auch reichsweite Strukturen abzeichneten. Diesen sollte auf Arbeitgeberseite mit einem Spitzenverband ein Pendant gegenübergestellt werden.
Am 19. März 1890 erfolgte die Gründung des Verbandes Deutscher Metallindustrieller als ein Verband der Verbände, zu dem zunächst fünf regionale Verbände (aus Berlin, Braunschweig, Hannover, Leipzig und Magdeburg) gehörten. Im Verlauf des Jahres schlossen sich fünf weitere Metallarbeitgeberverbände dem neuen Spitzenverband an.
Das spätere Kerngeschäft, die Koordinierung der Tarifpolitik, spielte noch gar keine Rolle. Verhandlungen mit Gewerkschaften über Flächentarifverträge wurden grundsätzlich abgelehnt. Erst ab 1906 beteiligte sich der Gesamtverband an regionalen Tarifverhandlungen mit dem Ziel, durch abgestimmtes Verhalten bessere Ergebnisse zu erzielen.
Den neutralen Boden, auf dem beide Seiten zusammenarbeiten konnten, bildete die Bismarcksche Sozialgesetzgebung. Mit Hilfe ihrer Organisationen konnten Gewerkschaften und Arbeitgeber ihre Verantwortung für die Arbeitsbeziehungen im Betrieb gegen jeden Eingriff von außen verteidigen. Das war die Voraussetzung für die spätere Tarifautonomie. Staatliche Zwangsschlichtungen waren damit ausgeschaltet.
Um dem Bestreben, die gesamte Metallindustrie des Deutschen Reichs zu einigen, besonderen Ausdruck zu verleihen, beschloss die erste Mitgliederversammlung des Verbandes am 9. Juni 1890 in Berlin, dass die Vereinigung fortan den Namen „Gesammt-Verband Deutscher Metall-Industrieller“ führen sollte.
Der erste „Gesamtmetall-Vorsitzende“ war der Berliner Metallindustrielle Paul Heckmann, Mitinhaber eines Kupferwalzwerkes. Heckmann beschränkte sich nicht auf seine Tätigkeit als Industrieller. Er war Ältester der Berliner Kaufmannschaft und später Vizepräsident der Handelskammer von Berlin. Sitz des Verbandes war die Reichshauptstadt Berlin. Die erste Repräsentanz lag in der Schlesischen Straße 25, gegenüber dem Heckmannschen Betrieb.
Der Gesamtverband hat seit seiner Gründung immer wieder zukunftsweisende Initiativen ergriffen und mit den Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie verwirklicht. Der Aufbau einer privaten Arbeitsvermittlung in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts für die Verbandsmitglieder ist hier ebenso zu nennen wie die Förderung der industriellen Berufsausbildung noch vor dem Ersten Weltkrieg.
Von größter Bedeutung für ganz Deutschland war es, daß sich 1918 Vertreter der Metallindustrie mit den Gewerkschaften zusammenfanden und sich über die grundsätzlichen Fragen einer Wirtschafts- und Sozialverfassung Deutschlands verständigten.
Sie führten den 8-Stunden-Tag ein, konzipierten die Betriebsverfassung und bekannten sich zur Tarifautonomie. Sie schufen die Voraussetzung dafür, daß auch in der Weimarer Republik die marktwirtschaftliche Ordnung im wesentlichen unangetastet blieb. Im Zusammenspiel mit den Gewerkschaften wurde das Tarifsystem der Weimarer Republik entwickelt und praktiziert, lange bevor das Wort von der Sozialpartnerschaft geboren war.
1933 war das schwärzeste Jahr von Gesamtmetall. Die Zerschlagung der Gewerkschaften durch die faschistischen Machthaber trieb die funktionslos gewordenen Arbeitgeberverbände in die Selbstauflösung.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren es nicht zuletzt die wiedererstandenen Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie, die sich frühzeitig für die Einführung der damals noch heftig umstrittenen Sozialen Marktwirtschaft einsetzten.
Mit dem Abschluß des ersten Schlichtungs- und Schiedsabkommens zwischen der IG Metall und Gesamtmetall im Jahre 1955 erteilten Arbeitgeber und Gewerkschaften jeder staatlichen Einmischung in ihre eigenverantwortliche Regelung der Arbeitsbeziehungen eine klare Absage.
Am 27. September 1990 wurde dann die deutsche Einheit auch bei den Arbeitgeberverbänden vollzogen, als sich die vier neugegründeten ostdeutschen Metall-Landesverbände Gesamtmetall anschlossen.
Im Jahr 2003 ist Gesamtmetall von Köln zurück an den historischen Sitz gezogen, nach Berlin-Mitte. Dieser Umzug in ein eigenes Haus erfolgte, um die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und anderen Verbänden besser wahrnehmen zu können.
2005 hat sich Gesamtmetall mit einer Satzungsänderung auch für Verbände ohne Tarifbindung geöffnet. Der neue Name – „Gesamtmetall – die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie“ – spiegelt dieses Selbstverständnis wider.
Am 19. März 2015 wurde Gesamtmetall 125 Jahre alt und hat dies am 12. Juni mit einem großen Festakt in Berlin in Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck gefeiert.
Verbandsgeschichte
1890Der „Verband Deutscher Metallindustrieller“ wird in Berlin als ein Verband der Verbände gegründet. Das spätere Kerngeschäft, die Koordinierung der Tarifpolitik, spielte zunächst keine Rolle. Der erste „Gesamtmetall-Vorsitzende“ nach der Gründung am 19.03. war der Berliner Metallindustrielle Paul Heckmann. Die Verbandsrepräsentanz lag in der Schlesischen Straße, gegenüber dem Heckmannschen Betrieb. In seine Amtszeit bis 1910 fiel vor allem das Werben um die Gründung und den Anschluss von regionalen Mitgliedsverbänden, die ursprünglich zur Streikabwehr entstanden waren, an den nationalen Spitzenverband.
1891Einen ersten verbindlichen Rahmen von Vorschriften zu den Arbeitsabläufen und zur allgemeinen Sicherheit in den Betrieben bot die „Normal-Arbeitsordnung des Gesamtverbandes. Sie wurde den Betrieben der Mitgliedsverbände zur Einführung empfohlen. Damals wurden die meisten Arbeitsschritte im Betrieb selbst ausgeführt.
1911Anton von Rieppel war einer der Gründungsväter des MAN-Konzerns und führte den Verband von 1911 bis 1919 durch die schwere Zeit des Ersten Weltkrieges. Für ihn hatten nur große und feste Organisationen genug Schlagkraft zur Interessendurchsetzung. Er setzte die Einigungsarbeit konsequent fort und initiierte die Gründung von Landesverbänden. In seine Amtszeit fiel auch das Stinnes-Legien-Abkommen 1918, welches die Grundlagen des Flächentarifvertragssystems legte.
1918Mit dem Stinnes-Legien-Abkommen verständigten sich Vertreter der Metallindustrie mit den Gewerkschaften über die grundsätzlichen Fragen einer Wirtschafts- und Sozialverfassung in der Weimarer Republik.
1920Eine prägende Gestalt der erschütterungsreichen Weimarer Republik – Ernst von Borsig setzte sozialpolitische Maßstäbe und engagierte sich für eine fundierte Berufsausbildung, die heute als Vorbild gilt: „Die Ausbildung muss auf eine Höhe gebracht werden, die es ermöglicht, einen Qualitätsarbeiter heranzuziehen, der mithelfen kann, den Ruf deutscher Arbeit im Ausland Geltung zu verschaffen und ihn zu erhalten.“ Seine Amtszeit dauerte bis 1933.
1933Die Tarifautonomie hatte in der staatlich gelenkten und gleichgeschalteten Wirtschaft des Dritten Reichs keinen Platz. Bis zum 13.12.1933 amtierte Rudolf Blohm, Mitinhaber der Werft Blohm & Voss, als kommissarischer Vorsitzender des Verbandes. Er leitete jene Mitgliederversammlung, in welcher der einstimmige Auflösungsbeschluss unter dem massiven Druck der Nationalsozialisten gefasst wurde.
1949Die Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden wird im Grundgesetz festgeschrieben. Gesamtmetall wurde am 25.03. (wieder) gegründet, der Neuaufbau verbandlicher Strukturen beginnt. Die Wiedergründung des Gesamtverbandes und das Aufleben des Tarifwesens im Wirtschaftswunder sind eng verknüpft mit dem Namen Hans Bilstein. Der sauerländische Automobilzulieferer war auch Verhandlungsführer beim Abschluss des ersten Schlichtungs- und Schiedsabkommens mit der IG Metall 1955: Jeder staatlichen Einmischung in die eigenverantwortliche Regelung der Arbeitsbeziehungen wurde eine Absage erteilt. Seine Amtszeit währte bis 1959.
1953Als Ausdruck sozialpolitischer Solidarität unter den Unternehmen wird die Gefahrengemeinschaft zur gegenseitigen finanziellen Unterstützung bei der Abwehr von Streiks gegründet.
1955Der Abschluss des ersten Schlichtungs- und Schiedsabkommens mit der IG Metall erteilte jeder staatlichen Einmischung in die eigenverantwortliche Regelung der Arbeitsbeziehungen eine klare Absage.
1958Mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft intensivierte sich die Kooperation der Metallarbeitgeberverbände. Dem Comité des Liason des Industries Metaliques Europeenes tritt auch Gesamtmetall bei.
1959Bei der Wahl von Dr.-Ing. Ludwig Caemmerer zum Vorsitzenden war absehbar, dass dieser die Aufgabe wegen seines Alters nur für eine kurze Zeit innehaben würde. Er setzte den von Hans Bilstein eingeschlagenen Weg sozialpartnerschaftlicher Verständigung fort und forcierte die Reform der innerverbandlichen Organisation und Meinungsbildung, vor allem durch die Verstärkung der tarifpolitischen Koordination durch Gesamtmetall. Er amtierte bis 1961.
1961Mit dem Amtsantritt des niederrheinischen Maschinenfabrikanten Herbert van Hüllen fand nicht nur ein Generationswechsel statt. Mit dem zunehmend unruhigen sozialpolitischen Klima erweitern sich auch die Schwerpunkte von Gesamtmetall, um „ein einheitliches Vorgehen der Mitgliedsverbände in allen Fragen von allgemeinem Interesse zu sichern“, wie es in der Satzung hieß. Die Geschäftsstelle wurde ausgebaut. Herbert van Hüllen stand bis 1976 an der Spitze von Gesamtmetall.
1962Unternehmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie ihre Produktionsmethoden ständig modernisieren. Deshalb gründete die Mitgliederversammlung von Gesamtmetall 1962 das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (ifaa). Es entwickelt praxisgerechte Lösungen für eine wettbewerbsfähige Arbeits- und Betriebsorganisation.
1977Mit Dr. Wolfram Thiele stand wieder ein MAN-Vorstand, aber erstmals ein Präsident an der Spitze. Die Mitgliederversammlung hatte die Bildung eines Präsidiums beschlossen. Seine Amtszeit bis 1985 war geprägt von einer Achterbahnfahrt: Extrem hohen Wachstumsraten folgten Jahre mit sinkender Produktion. Auch der Verteilungskonflikt mit der IG Metall erhielt durch die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche eine neue Qualität.
1984Der sogenannte Leber-Kompromiss von 1984 bot den Unternehmen erstmals die Möglichkeit, ihr Arbeitszeitvolumen zu variieren und modernen Produktionsstrukturen gerecht zu werden. Der Kompromiss basierte auf dem „Tausch“: Weniger Wochenarbeitszeit gegen mehr Flexibilität.
1985Das Thema Arbeitszeit konnte erst in der Präsidentschaft von Dr. Werner Stumpfe (bis 1992), Vorstand der Mannesmann Demag AG, befriedet werden: Die Wochenarbeitszeit wurde mit Lohnausgleich weiter verkürzt, im Gegenzug wurde die Arbeitszeitgestaltung spürbar flexibilisiert. Mit der Wiedervereinigung rückte der Neuaufbau von Verbandsstrukturen in Ostdeutschland in den Fokus.
27.09.1990Die vier neu gegründeten ostdeutschen Metall-Landesverbände schließen sich Gesamtmetall an. Damit wurde die deutsche Einheit auch bei den Arbeitgeberverbänden vollzogen.
1992Mit Dr. Hans-Joachim Gottschol, geschäftsführender Gesellschafter der Gottschol-Aluminium GmbH in Ennepetal im südlichen Ruhrgebiet, übernahm wieder ein Mittelständler bis 1996 die Verbandsführung. In die schwierige wirtschaftliche und tarifpolitische Zeit der Nachwendejahre fiel auch die Debatte um die Rückkehr des Verbandes von Köln nach Berlin.
1996In Personalunion von Ehren- und Hauptamt hat Dr. Werner Stumpfe den Verband zum zweiten Mal bis 2000 und in einer kritischen Phase gelenkt. Mit bundesweiten Strukturen von Verbänden ohne Tarifbindung wurde die Möglichkeit geschaffen, Firmen zu halten, die sich sonst komplett verabschiedet hätten. Gleichzeitig legte er mit der angebotenen „Neuen Partnerschaft“ die Grundlage für einen konstruktiveren Dialog mit der IG Metall.
2000Für den mittelständischen Wäschereitechnik-Unternehmer Martin Kannegiesser aus dem westfälischen Vlotho galt es, die betriebliche Wirklichkeit in allen Facetten auf den Flächentarifvertrag zu übertragen – nicht umgekehrt. In seine Amtszeit bis 2012 fielen mit der Gründung der MetallRente, dem ERA-Tarifvertrag und Pforzheimer Abkommen, dem flexiblen Renten-Übergang und dem Krisentarifvertrag wegweisende Entscheidungen.
2001Das von den Sozialpartnern getragene Branchenversorgungswerk MetallRente wird gegründet und entwickelt sich binnen kurzem zur größten Einrichtung ihrer Art in Deutschland. Bereits zur Jahrhundertwende 1900 beschäftigte sich der Gesamtverband mit dem Thema Altersvorsorge: Überlegt wurde, für alle M+E-Mitarbeiter eine Lebensversicherung sowie eine gemeinsame Pensions- und Unterstützungskasse anzubieten – zu vorteilhaften Großkunden-Tarifen.
2002Die Lohnrahmentarifverträge für Arbeiter und die Gehaltsrahmentarifverträge für Angestellte werden zu einem gemeinsam geltenden Entgeltrahmentarifvertrag (Fachsprache: ERA) zusammengeführt.
2003Nach fast 50 Jahren in Köln zog der Verband nach Berlin um – an den Ort der einstigen Gründung. Am Potsdamer Platz wird ein neues Gebäude auf historischem Boden bezogen.
25.02.2004Mit dem richtungweisenden Pforzheimer Abkommen wurde der Flächentarifvertrag modernisiert und flexibilisiert. Überbetriebliche Notwendigkeiten können einfacher in Einklang gebracht werden.
2010Der Krisentarifabschluss zeigte die besondere Verantwortung der Sozialpartner. In der bis dahin größten Rezession der Nachkriegsgeschichte wurden mehr als 800.000 Arbeitsplätze gesichert und die Realeinkommen stabilisiert.
2012Für den geschäftsführenden Gesellschafter der Prominent GmbH in Heidelberg, Dr. Rainer Dulger, waren die Bewahrung der Flexibilität der M+E-Unternehmen und die Modernisierung des Flächentarifvertrags wichtige Anliegen. Seine Amtszeit bis 2020 prägten lange Jahre wirtschaftlicher Prosperität. Erstmals seit der Wiedervereinigung wurde 2018 die Marke von vier Millionen M+E-Beschäftigten wieder übertroffen. Erst der Beginn der Corona-Krise brachte diese Entwicklung zum Stillstand.
19.03.2015Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall wird 125 Jahre alt und feiert dies mit einem großen Festakt in Berlin in Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck.
201830 Jahre mobile Berufsinformation: Mehr als sechseinhalb Millionen Besucher, die meisten davon Schülerinnen und Schüler, haben seit 1988 die Info-Mobile und Info-Trucks der Metall- und Elektro-Industrie besucht.
15.11.2018100 Jahre Stinnes-Legien-Abkommen: Mit der wegweisenden Einigung erkannten sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gegenseitig an – die eigentliche Geburtsstunde des heutigen Tarifsystems und der Tarifautonomie.
2020 Von November 2020 bis Ende 2025 amtierte Dr. Stefan Wolf, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers ElringKlinger AG, als Präsident von Gesamtmetall. Der mittelständische Unternehmer war bereits seit langem ehrenamtlich in den M+E-Verbänden engagiert. Er hatte mitten in der Corona-Zeit das Amt übernommen und für den Standort, die Branche und die Unternehmen in schwierigen Zeiten mit enormem Engagement, unermüdlicher Energie und klaren Worten gekämpft.
2020Die Corona-Pandemie stellte die Tarifrunde 2020 unter besondere Herausforderungen. Am Ende konnte ein Lösungsansatz für die aktuellen Probleme, wie Kurzarbeit und Kinderbetreuung im Lockdown, gefunden werden – und zwar ohne nennenswerte Mehrkosten für die Betriebe und mit Planungssicherheit für die Beschäftigten.
01.06.2021In Berlin/Brandenburg und Sachsen wird erstmals eine Öffnung für Betriebe zur Angleichung der Arbeitszeit in Ost und West vereinbart. Die Betriebe können damit freiwillig unter Vereinbarung einer Kompensation die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden absenken.
2023Welche politischen Konzepte gibt es, um die Soziale Marktwirtschaft zu stärken, unser Land zu modernisieren und wettbewerbsfähig für die Zukunft zu gestalten? Das war das Thema des ersten Tags der Metall- und Elektro-Industrie – mit viel politischer Prominenz. Die neue Veranstaltungsreihe findet künftig jedes Jahr statt.
2026Seit dem 01.01.2026 ist Dr. Udo Dinglreiter neuer Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Der Mitinhaber und Geschäftsführer des Maschinen- und Anlagenbauers R. Scheuchl GmbH im bayerischen Ortenburg ist der 15. Präsident in der 135-jährigen Geschichte von Gesamtmetall. Damit ist er der zweite bayerische Gesamtmetall-Präsident nach Anton von Rieppel (1911 bis 1919) und der erste aus einem nicht tarifgebundenen Unternehmen.
Die meisten Bilder stammen aus der Chronik „100 Jahre Gesamtmetall“ von Luitwin Mallmann (1990). Das Foto von Anton von Rieppel ist aus dem historischen Archiv der MAN AG Augsburg, das Foto von Ernst von Borsig von ullstein bild – Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl.

1890 – 1910: Paul Heckmann
Mitinhaber eines Kupferwalzwerkes

1911 – 1919: Anton von Rieppel
MAN

1920 – 1933: Ernst von Borsig
Borsigwerke

1933: Rudolf Blohm
(Komm. Vors.) Blohm und Voss

1949 – 1959: Hans Bilstein
August Bilstein

1959 – 1961: Dr. Ludwig Caemmerer
Hilger AG

1961 – 1976: Herbert van Hüllen
Becker und van Hüllen

1977 – 1985: Dr. Wolfram Thiele
MAN Gutehoffnungshütte AG
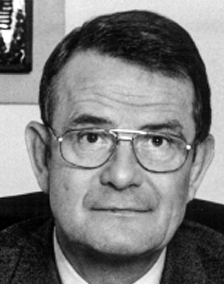
1985 – 1991: Dr. Werner Stumpfe
Mannesmann Demag AG

1992 – 1996: Dr. Hans-Joachim Gottschol
Gottschol Aluminium GmbH
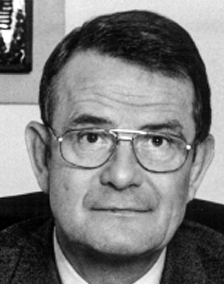
1996 – 2000: Dr. Werner Stumpfe
geschäftsführender Präsident

2000 – 2012: Martin Kannegiesser
Herbert Kannegiesser GmbH

2012 – 2020: Dr. Rainer Dulger
ProMinent GmbH

2020 – 2025: Dr. Stefan Wolf
vormals ElringKlinger AG

seit 2026: Dr. Udo Dinglreiter
Mitgesellschafter und Geschäftsführer der R. Scheuchl GmbH
Als am 19. März 1890, einen Tag vor Bismarcks Rücktritt, der „Verband Deutscher Metallindustrieller“ in Berlin gegründet wurde, befanden sich die Eigentümer der Voßstraße 16 auf einer Reise in Rom. Damals ahnte noch niemand, dass Verband, Adresse und in gewisser Weise auch die Nachfahren der ehemaligen Besitzer über hundert Jahre später, nach einschneidenden welthistorischen Ereignissen, zusammenkommen würden.
Rund 20 Jahre vor der Verbandsgründung wurde das Deutsche Kaiserreich proklamiert, und damit beginnt auch die Geschichte des Grundstücks. Ungefähr in den heutigen Grenzen erscheint es erstmals in einem Plan der Deutschen Bau-Gesellschaft von 1871, der den Bau einer „Neuen Strasse“ im Regierungsviertel zwischen der Wilhelmstraße und Königgrätzerstraße (heute: Ebertstraße), auf dem ehemaligen Voß’schen Gelände vorsah.
Am 22. April 1872 erwarb der Privatbankier Friedrich Meyer (1820-1881) das Grundstück Nr. 16 (zuerst als 15, dann 15a gezählt) und ließ darauf im Stil der italienischen Neorenaissance eine Villa errichten. Der Einzug der Familie und des Bankhauses E. J. Meyer erfolgte 1875.
Das Erbe des Bankiers übernahm sein Sohn, der Germanist Richard M. Meyer (1860-1914). Er und seine Frau Estella (1870-1942) führten ein geselliges und künstlerisches „offenes Haus“, in dem – Angehörige des Hochadels ausgenommen – regelmäßig Repräsentanten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur verkehrten. 1914 erlitt diese Blüte der Geselligkeit mit Meyers Tod einen jähen Einbruch.
Das für die Vertreter der Metallindustrie zukunftsweisende Jahr 1918 brachte für die Familie den allmählichen Niedergang: ein Sohn fiel vor Verdun, die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, Rezession und Inflation in den 1920er Jahren bedeuteten erhebliche Einbußen für das vormals immense Vermögen, mehr und mehr Partien des Hauses wurden vermietet.
Die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten führte noch 1933 zur Selbstauflösung des Arbeitgeberverbandes, bedeutete aber für die Familie erst den Anfang der Repressionen: Bereits 1936 wurden Meyers zum Verkauf des Grundstücks gezwungen, da die gesamte Nordseite der Voßstraße dem Neubau der Reichskanzlei weichen musste. Als eines der letzten Gebäude wurde die Meyer’sche Villa 1938 abgerissen. Doch auch von der 1939 eingeweihten Neuen Reichskanzlei blieben nach Kriegsende nur Ruinen – Meyers überlebten die Judenverfolgung in Berlin, mussten nach Kriegsende mehrere Jahre in Flüchtlingslagern verbringen und ließen sich schließlich in Hessen nieder.
Berlins alte Mitte mit dem Regierungsviertel fand sich im sowjetischen Sektor. Die restliche Bausubstanz von Alter und Neuer Reichskanzlei wurde abgetragen, 1959 das gesamte Gelände eingeebnet und die Stahlbetontrümmer und Bunkeranlagen durch einen „Hügel“ übererdet, der nach dem Bau der Mauer 1961 im so genannten „Todesstreifen“ lag. Wo einst das Machtzentrum des Deutschen Reiches gewesen war, befand sich nun ein Vakuum.
Im November 1989 wurde die Mauer an der Leipziger Straße geöffnet, wenige hundert Meter von der einstigen Voßstraße Nr. 16 entfernt. Das aus den Akten der 1930er Jahre rekonstruierbare Grundstück wurde 1999 an die Erbengemeinschaft Meyer zurückgegeben und von dieser an die Züblin Projektentwicklung verkauft. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall erwarb das noch im Bau befindliche Objekt und bezog es im Herbst 2003. Die „Villa Voß“ knüpft in vielerlei Hinsicht – nicht nur in der Namensgebung – an eine Tradition an, die 70 Jahre zuvor gewaltsam zerstört worden ist. Die Nummer 16 befindet sich erneut in einer exklusiven und politisch zentralen Lage.
Mit dem neuen Verbandssitz, gleich neben dem Potsdamer Platz und nur wenige Minuten vom Brandenburger Tor entfernt, ist Gesamtmetall an seinen historischen Gründungsort zurückgekehrt:
„Es ist aber weniger die Erinnerung an die Vergangenheit als vielmehr die Gestaltung der Zukunft, die uns antreibt und uns den Weg nach Berlin gewiesen hat. Die räumliche Nähe zu den anderen Spitzenverbänden, zu den Schaltstellen der Politik und zu den Medien der Hauptstadt wird wieder hergestellt. Auf diesen kurzen Wegen ist der unkomplizierte und rasche Austausch der Ideen und Gedanken möglich, der für eine effektive Arbeit unseres Verbandes unerlässlich ist.“
(Martin Kannegiesser, Ehrenpräsident von Gesamtmetall, anlässlich der Einweihungsfeier 2003)
Aus dem Architekturführer „Gesamtmetall Villa Voß Berlin“ von Cornelia Dörries
„Wo einst die Villa Voß, die namensgebend für die Straße war, stand, erhebt sich nun ein Bürogebäude, das den Arbeitgeberverband Gesamtmetall beherbergt. Entworfen wurde es vom Berliner Architekten Walter A. Noebel, der durch geschickte Vor- und Rücksprünge Terrassen und Erker für die Geschäftsräume entstehen ließ. Der kleine Garten hinter dem Gebäude dient nicht nur als Ort der Ruhe, hier finden auch Veranstaltungen statt. Gesamtmetall hat mit diesem schlichten Gebäude seinen Platz im Zentrum Berlins gefunden.“