Lars Kroemer
Abteilungsleiter Volkswirtschaft und Statistik
Telefon: 030-55150-210
E-Mail: kroemer@gesamtmetall.de
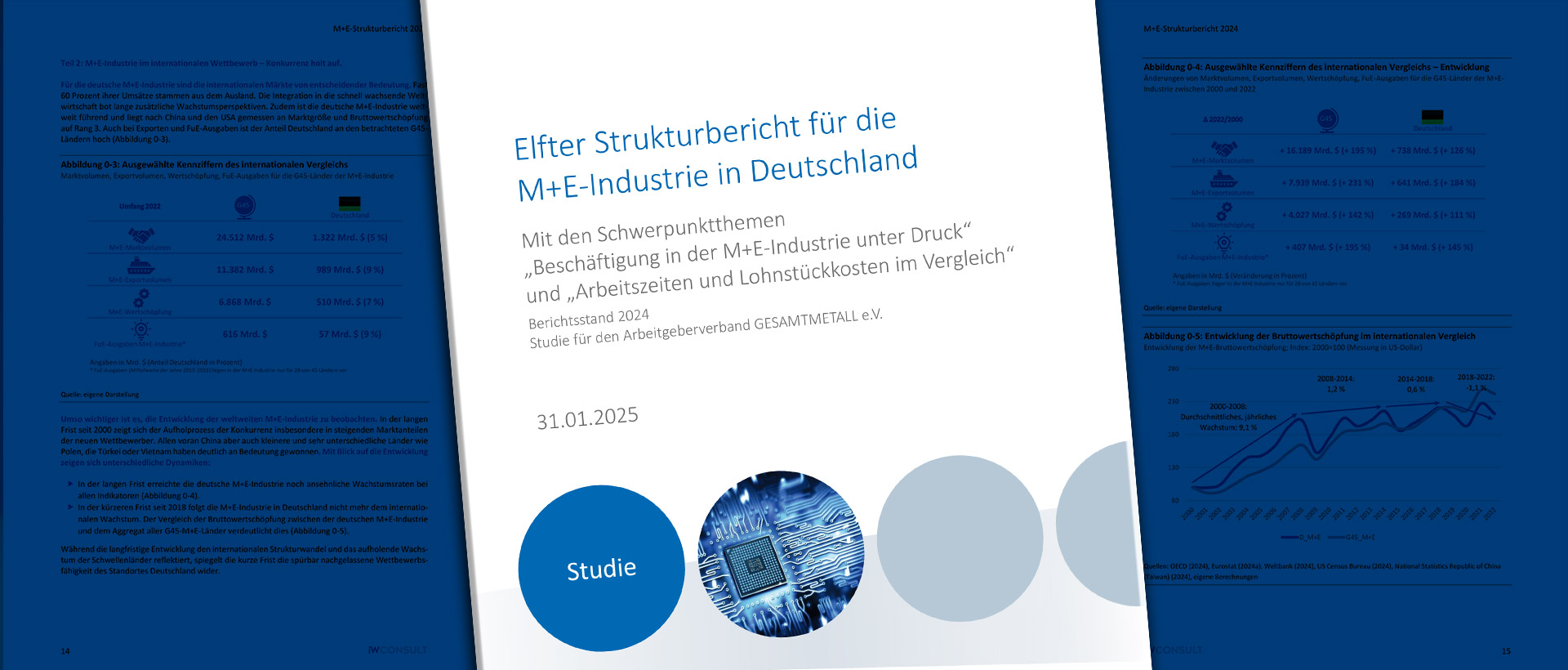
Die aktuelle Standortkrise setzt den Wohlstandstreiber M+E-Industrie erheblich unter Druck. Das reale Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ist seit 2019 praktisch nicht gewachsen. Damit befindet sich Deutschland in der längsten Wachstumsschwäche in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein wesentlicher Teil der Krise besteht darin, dass in der M+E-Industrie wie im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt seit 2018 keine positive Entwicklungsdynamik zu erkennen ist.
Die Gründe für die Standortkrise sind vielfältig. Hohe Kosten am Standort Deutschland, vor allem bei Energie-, Rohstoff- und Materialkosten sowie bei den Arbeitskosten, aber auch bei Belastungen durch Bürokratie vermindern die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Die Kostenbelastungen schwächen die Nachfrage aus dem Ausland, zumal neue Konkurrenten gleichzeitig deutlich an Produktivität und Innovationskraft gewonnen haben. Seit 2018 ist die Dynamik der deutschen M+E-Industrie auf den Exportmärkten gebremst. Der sprunghafte wirtschaftspolitische Kurs in Deutschland verschärft gleichzeitig die Unsicherheiten und damit die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Die privaten Investitionen sind regelrecht eingebrochen, was neben aktuellen konjunkturellen Aspekten nachhaltig ein Problem für die Perspektiven der M+E-Industrie in Deutschland darstellt.
Der Erfolg auf den Exportmärkten zählt eigentlich zu den traditionellen Stärken der M+E-Industrie. 59 Prozent der Umsätze erwirtschaftet die deutsche M+E-Industrie im Ausland. Damit werden drei Viertel der Auslandsumsätze des Verarbeitenden Gewerbes von M+E-Betrieben erzielt. Die M+E-Industrie konnte sich im internationalen Wettbewerb in der langfristigen Perspektive gegenüber dem Aufkommen neuer Wettbewerber gut behaupten und die Chancen der Globalisierung nutzen. Jetzt verliert sie aber zunehmend an Boden.
Hintergrund ist, dass bei den traditionellen Vorteilen der deutschen M+E-Industrie – FuE-Intensität, Produktdiversifizierung und -komplexität, Technologieorientierung – die neuen Wettbewerber immer stärker aufholen. So hat sich beispielsweise der Abstand zwischen den FuE-Intensitäten in den M+E-Industrien Chinas und Deutschlands um 4-Prozent-Punkte verringert, während die absoluten FuE-Aufwendungen der M+E-Industrie in China heute bei fast dem dreifachen Wert der Aufwendungen in Deutschland liegen. Für den Erfolg im internationalen Wettbewerb bleiben diese Wettbewerbsfaktoren für die deutschen M+E-Industrie aber entscheidend, sonst können die höheren Kosten am Standort immer weniger durch eine entsprechend höhere Produktivität wettgemacht werden.
Der aktuelle Schwerpunkt widmet sich daher dem internationalen Vergleich der Arbeitszeiten und Lohnstückkosten in der M+E-Industrie. Geringe Arbeitszeiten sprechen dafür, dass das Potenzial des Humankapitals in Deutschland nicht ausreichend genutzt wird. Auch deshalb können die hohen Arbeitskosten nicht mehr durch eine höhere Produktivität ausgeglichen, sodass die Lohnstückkosten in der deutschen M+E-Industrie höher ausfallen als bei allen relevanten Wettbewerbsregionen.
Im Ergebnis sank der Anteil Deutschlands an den weltweiten M+E-Exporten von zwischenzeitlich über 12 Prozent (2003-2005) auf nun rund 9 Prozent. Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung fällt entsprechend hinter den Wettbewerbern zurück. 2022 fiel der Anteil Deutschlands an der globalen M+E-Wertschöpfung auf nur noch 7 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2000. Am aktuellen Rand führt diese Entwicklung zu Arbeitsplatzverlusten. Auf die Phase des Beschäftigungsaufbaus bis 2019 folgte bis 2023 schon ein Rückgang von rund 90.000 Beschäftigten, der sich nun beschleunigt. Der elfte M+E-Strukturbericht zeigt damit ganz deutlich, dass die neue Bundesregierung schnell und entschieden handeln muss, um den Standort zu retten.